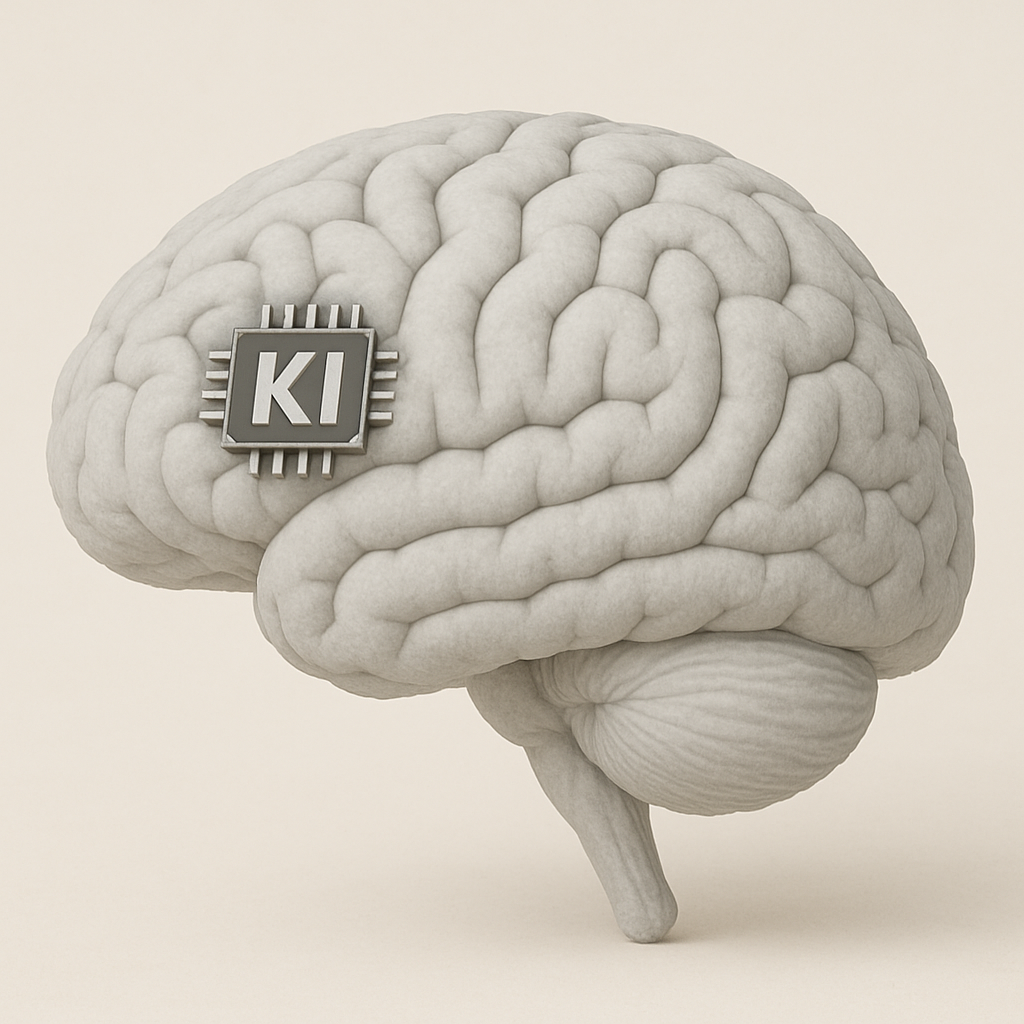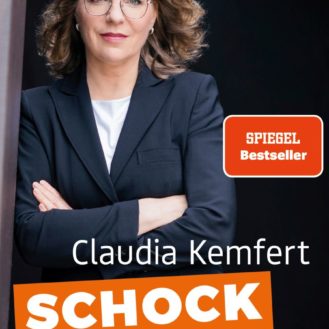Künstliche Intelligenz am Wendepunkt
Ray Kurzweil, einer der einflussreichsten Vordenker der Künstlichen Intelligenz (KI), prognostiziert in einem Interview mit DER ZEIT für das Jahr 2029 den Moment, in dem Maschinen erstmals die menschliche Intelligenz übertreffen – die sogenannte Singularität. Dabei handelt es sich um einen Wendepunkt, an dem Computer schneller, effizienter und günstiger in der Lösung geistiger wie manueller Aufgaben sein werden als Menschen. Diese Entwicklung wird laut Kurzweil das gesamte menschliche Leben grundlegend verändern – von Medizin und Bildung über Arbeit und Kreativität bis hin zur Frage, was es überhaupt bedeutet, Mensch zu sein.
Technologische Sprünge und Anwendungen
Kurzweil beschreibt anhand aktueller Beispiele, wie schnell KI-Fortschritte derzeit voranschreiten: Eine KI fasst seine noch unveröffentlichte Autobiografie präzise zusammen, produziert Podcasts mit synthetischen Stimmen und versteht mittlerweile komplexe Zusammenhänge sowie Humor. Möglich wird all das durch exponentiell wachsende Rechenleistungen. Während Computer 1941 für einen Dollar lediglich sieben Berechnungen durchführten, leisten sie heute eine halbe Billion – pro Sekunde.
Verschmelzung von Mensch und Maschine
Ein zentraler Aspekt seiner Zukunftsvision ist die Verschmelzung von Gehirn und KI. In etwa vier Jahren, so Kurzweil, könnten Implantate den Neokortex – den für Denken, Sprache und Planung zuständigen Teil des Gehirns – direkt mit Computern verbinden. Informationen würden dann ohne bewusste Trennung zwischen biologischem Gedächtnis und digitalem Wissen abgerufen. Damit einhergehe eine exponentielle Steigerung menschlicher Intelligenz und kultureller Entwicklung.
Risiken und gesellschaftliche Umwälzungen
Kurzweil räumt ein, dass diese Entwicklung auch große Risiken birgt. Die Gefahr, dass Maschinen sich selbst weiterentwickeln und den Menschen überflügeln, sei real – wenn man nicht aufpasst. Ebenso drohten massive gesellschaftliche Verwerfungen: Millionen Arbeitsplätze könnten durch KI wegfallen, etwa in Banken, Versicherungen oder der Werbebranche. Er plädiert für eine Kombination aus Grundeinkommen, sozialer Stabilisierung und einer Vision, die Menschen motiviert, sich weiter als Teil der Entwicklung zu verstehen.
Optimismus trotz Gefahren
Trotz all dieser Herausforderungen bleibt Kurzweil grundlegend optimistisch – oder, wie er es nennt: Realist. Der technische Fortschritt habe das Leben der Menschen historisch betrachtet immer verbessert – Hunger, Krankheiten, Armut und Gewalt seien global rückläufig. Die Angst vor der Zukunft sei verständlich, aber oft durch eine romantisierte Rückschau auf die Vergangenheit verzerrt. Technologie sei kein außerirdischer Eingriff, sondern Ausdruck menschlicher Kreativität.
zum Weiterlesen, bitte kostenlos registrieren