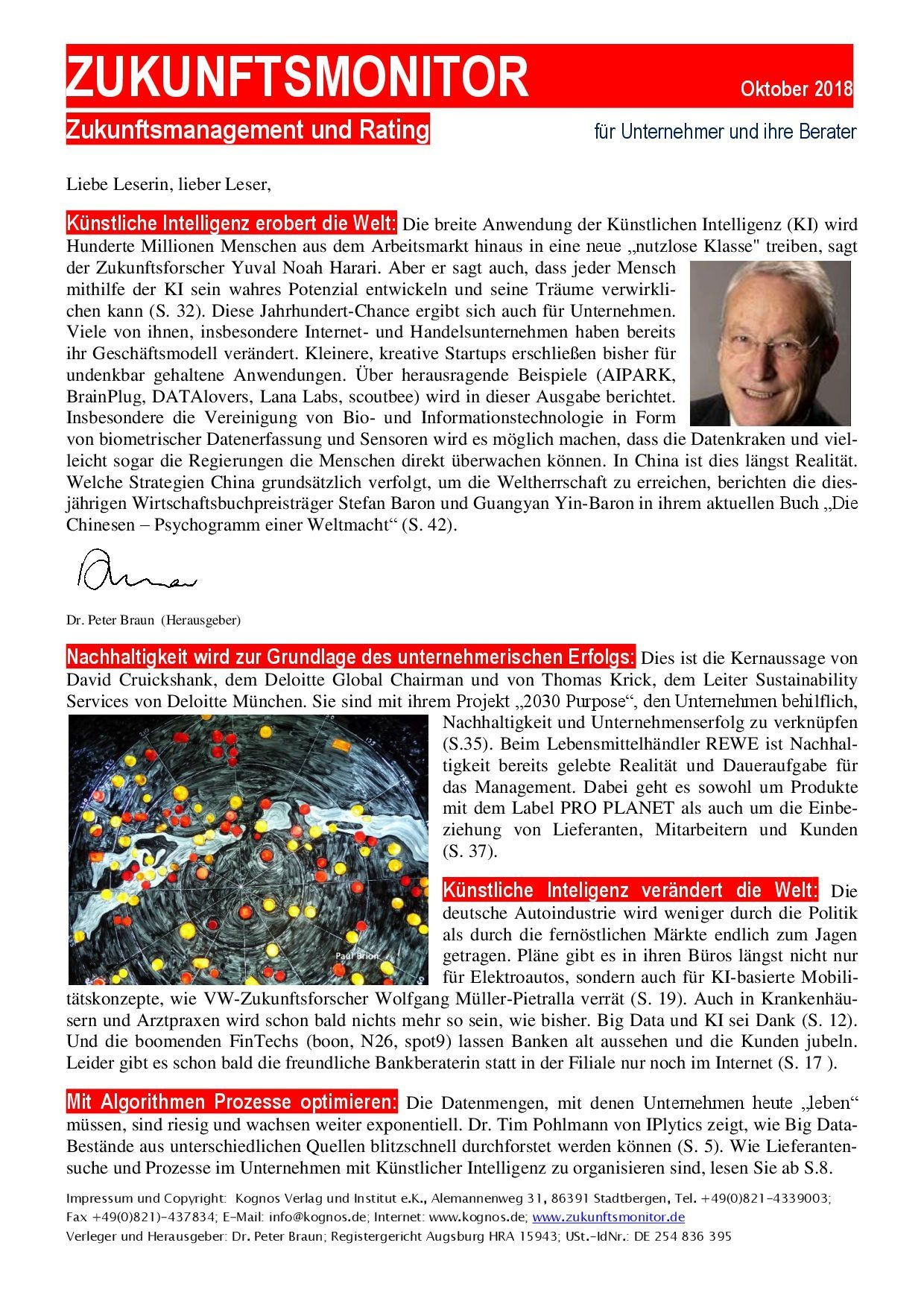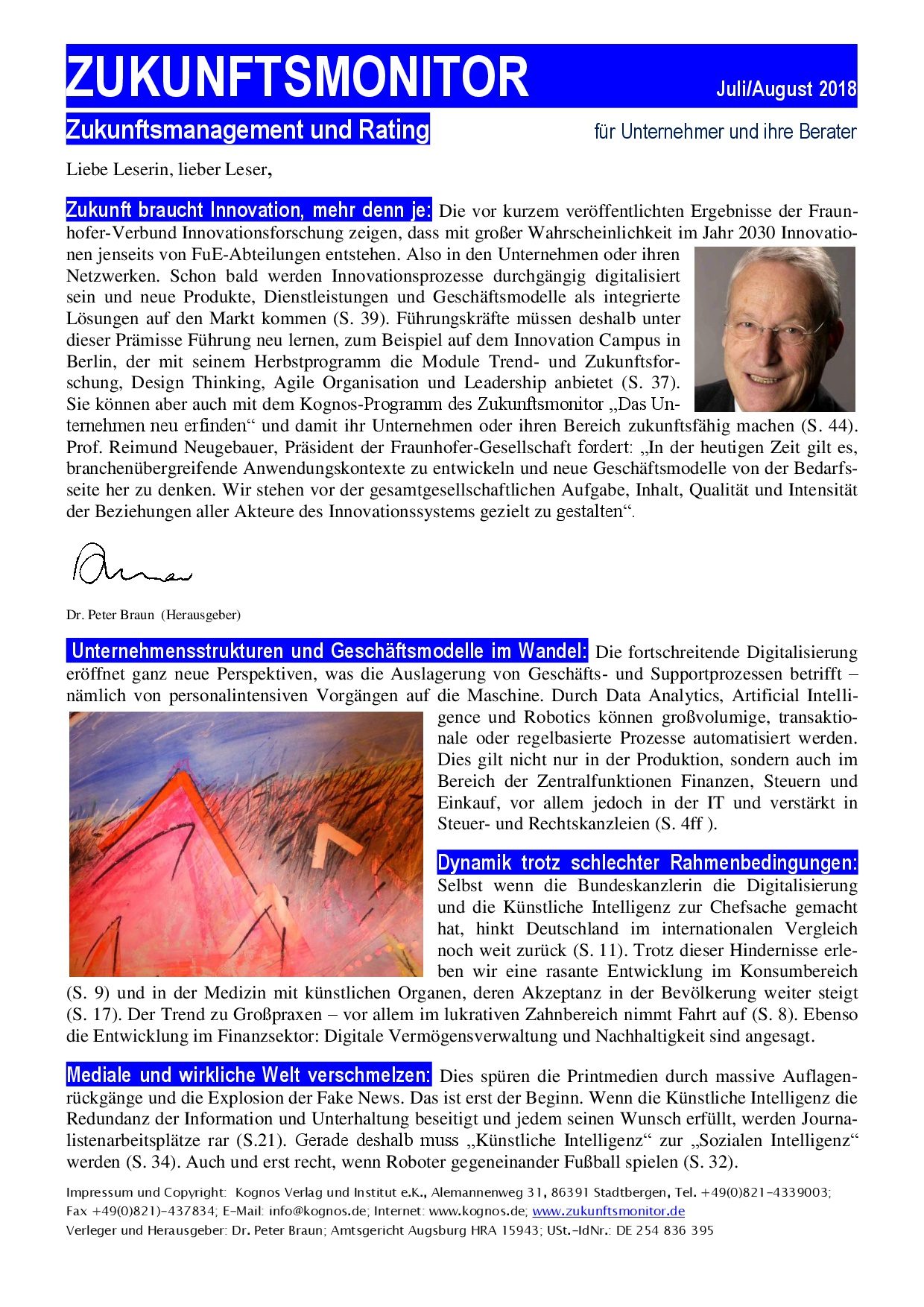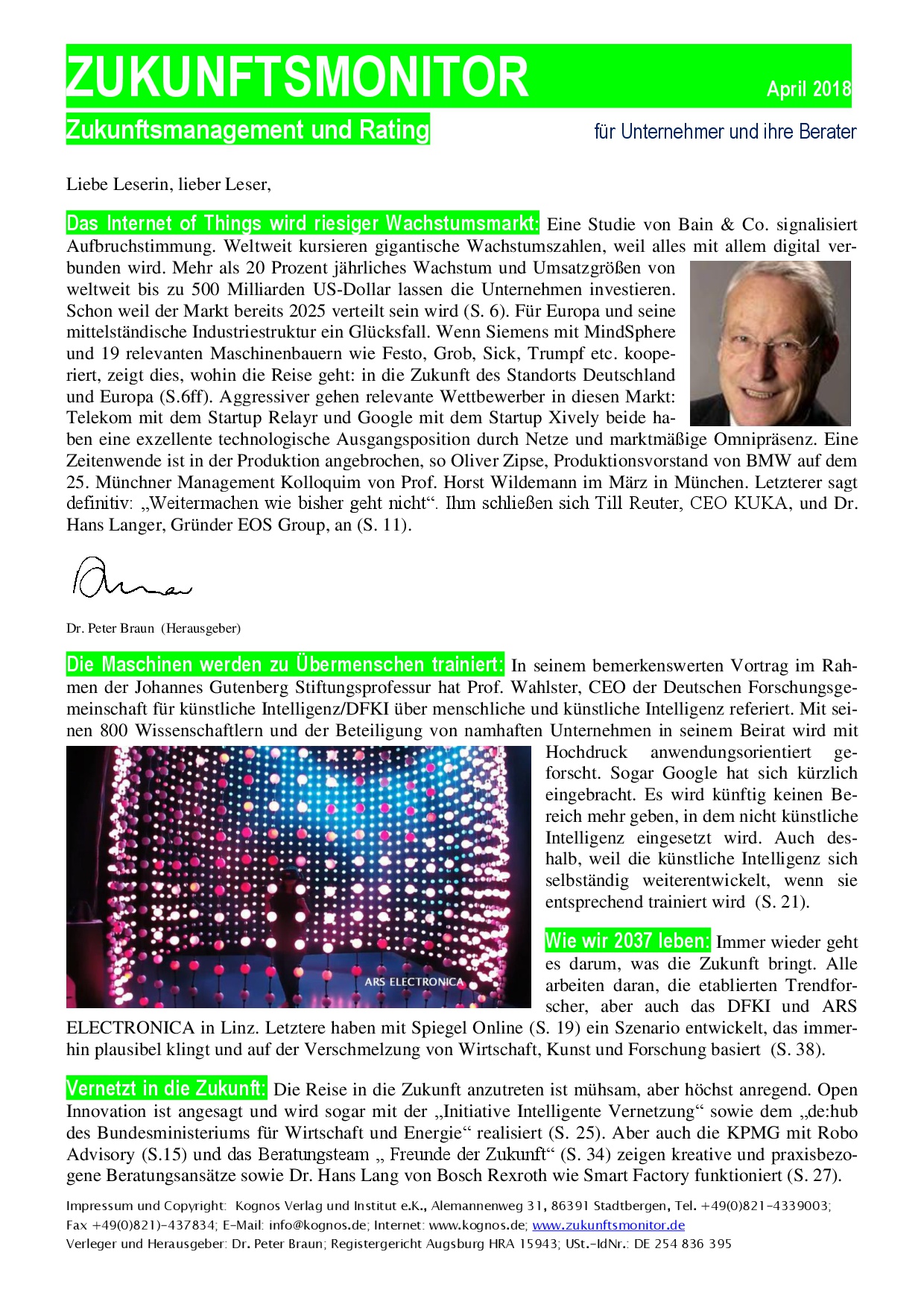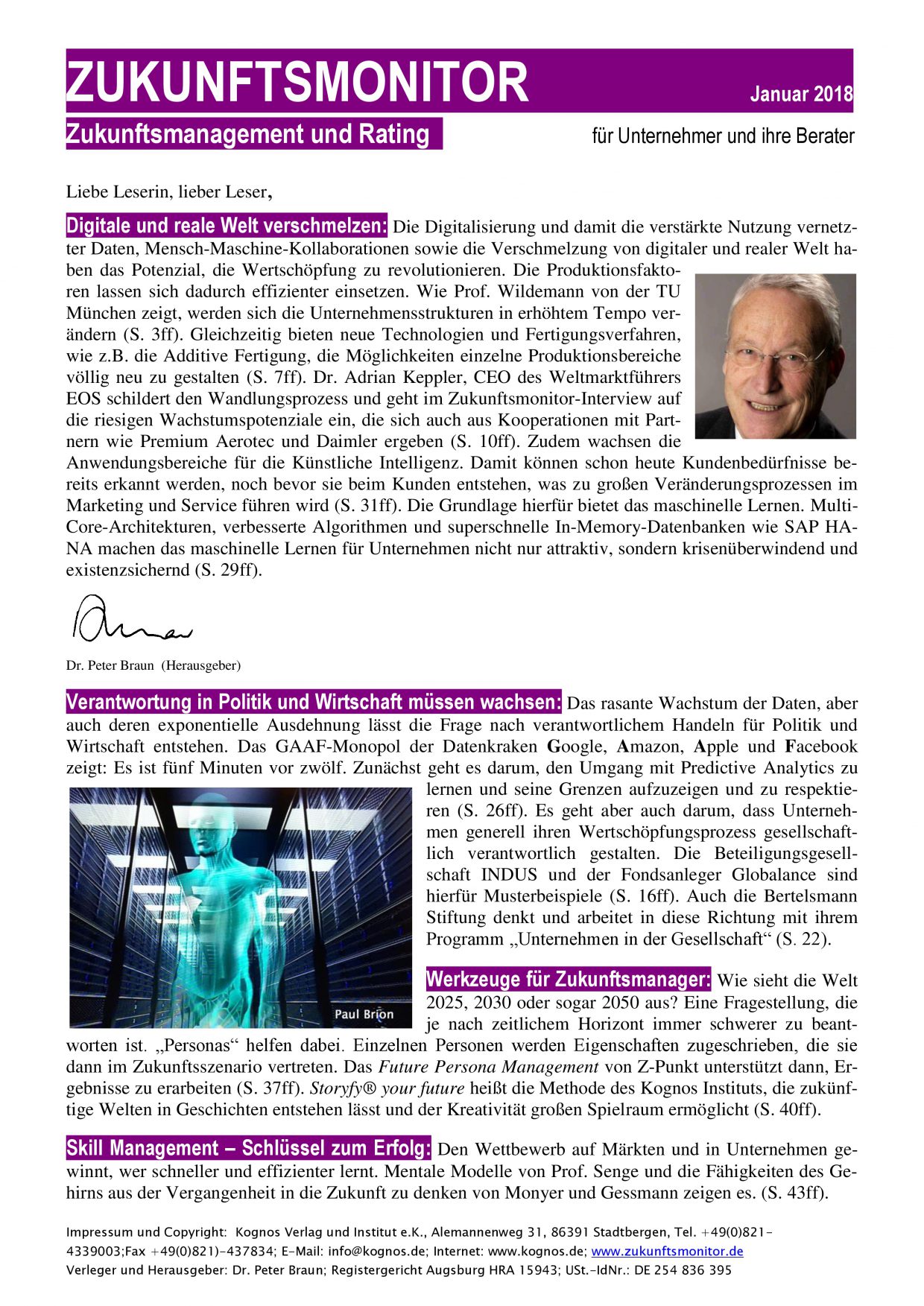Zukunftsmonitor Printausgaben
2021
Zukunftsmonitor 3./4. Quartal 2021

Zukunftsmonitor 2. Quartal 2021
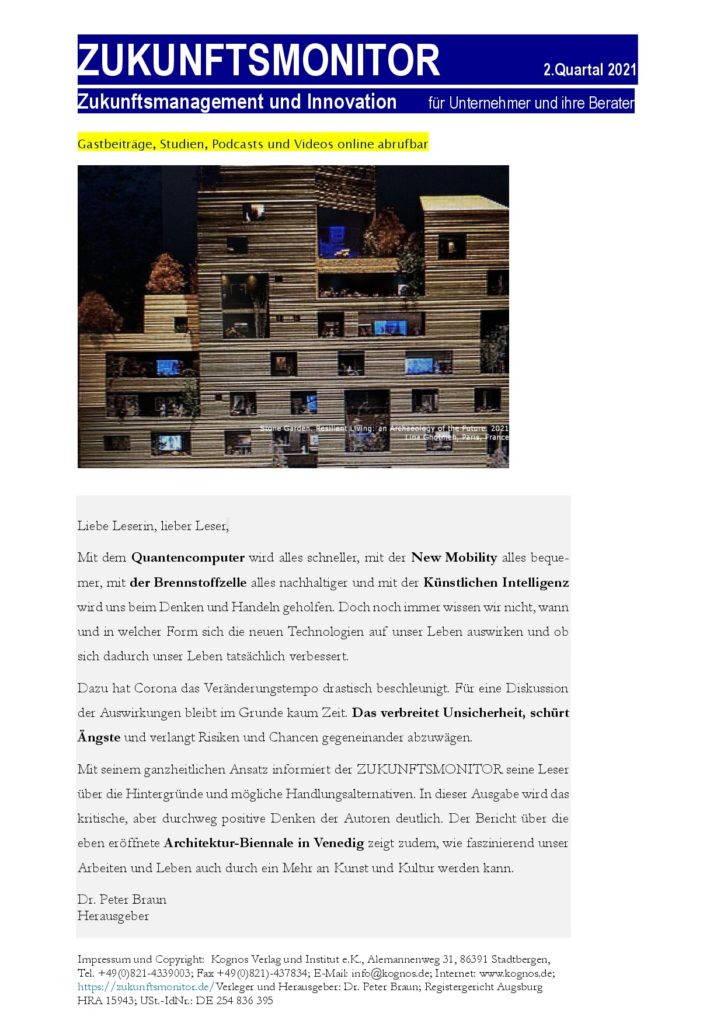
Zukunftsmonitor 1. Quartal 2021
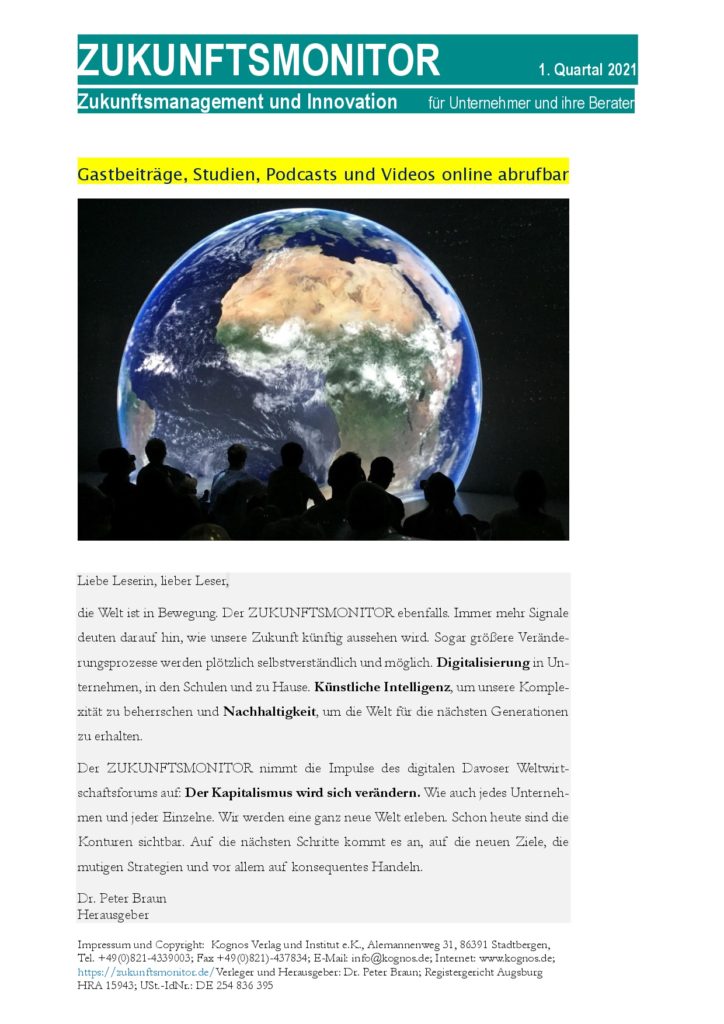
2020
Zukunftsmonitor 4. Quartal 2020

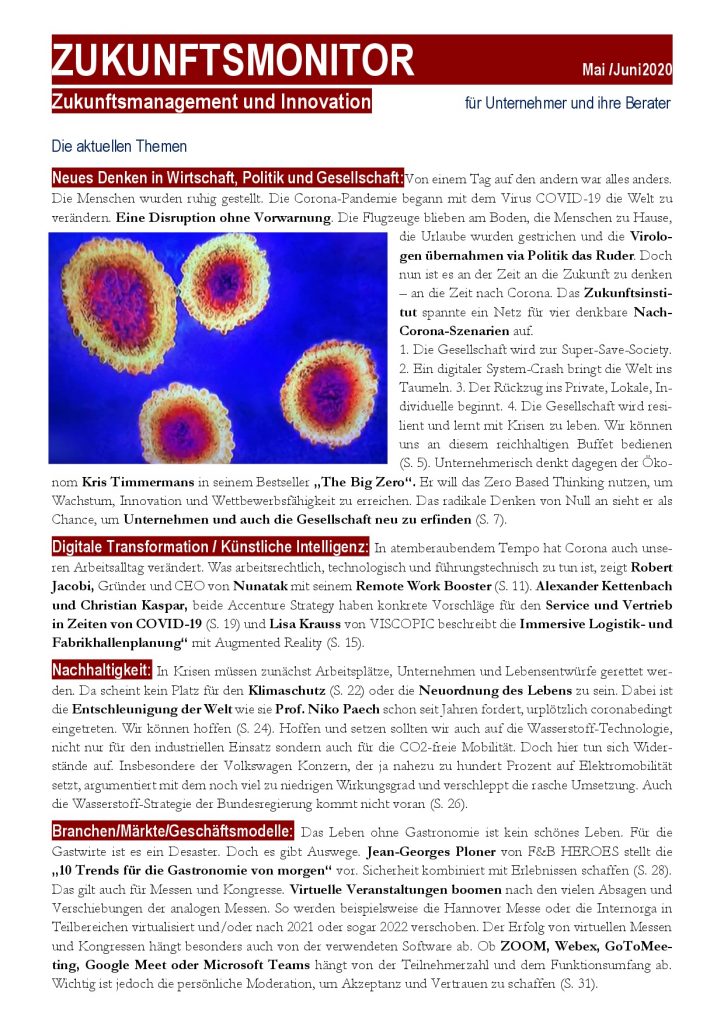
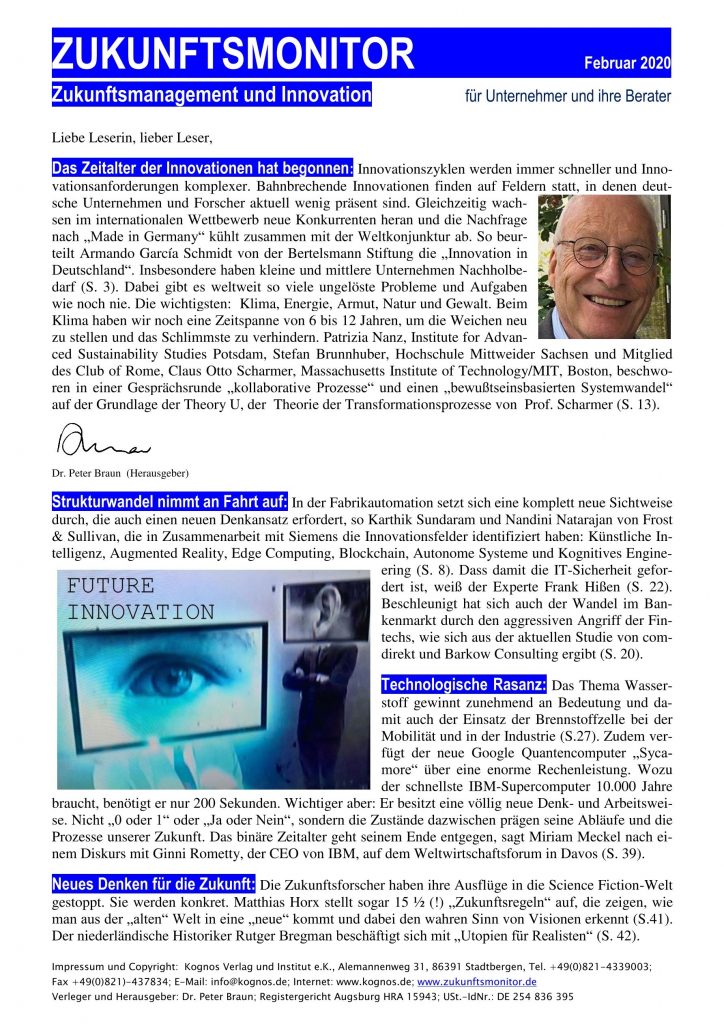
2019
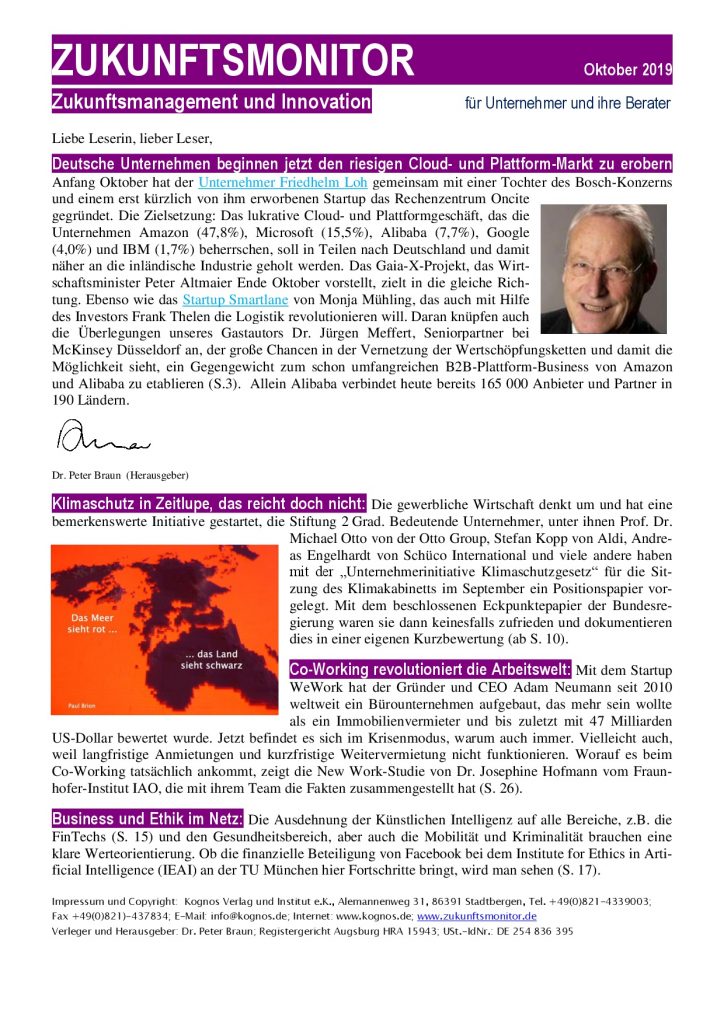
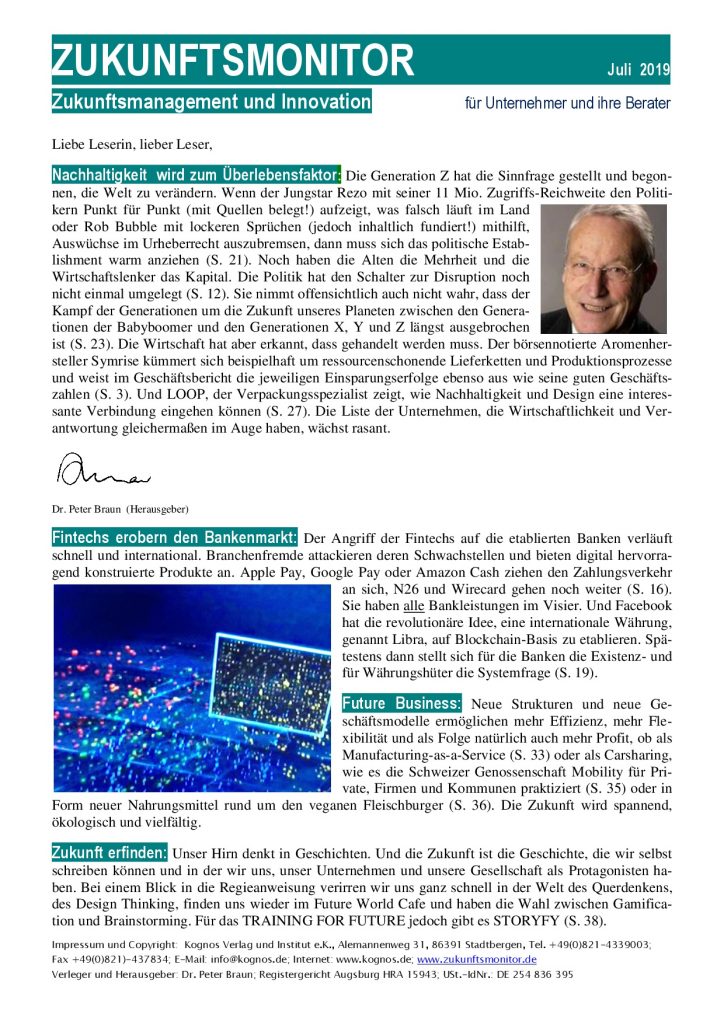
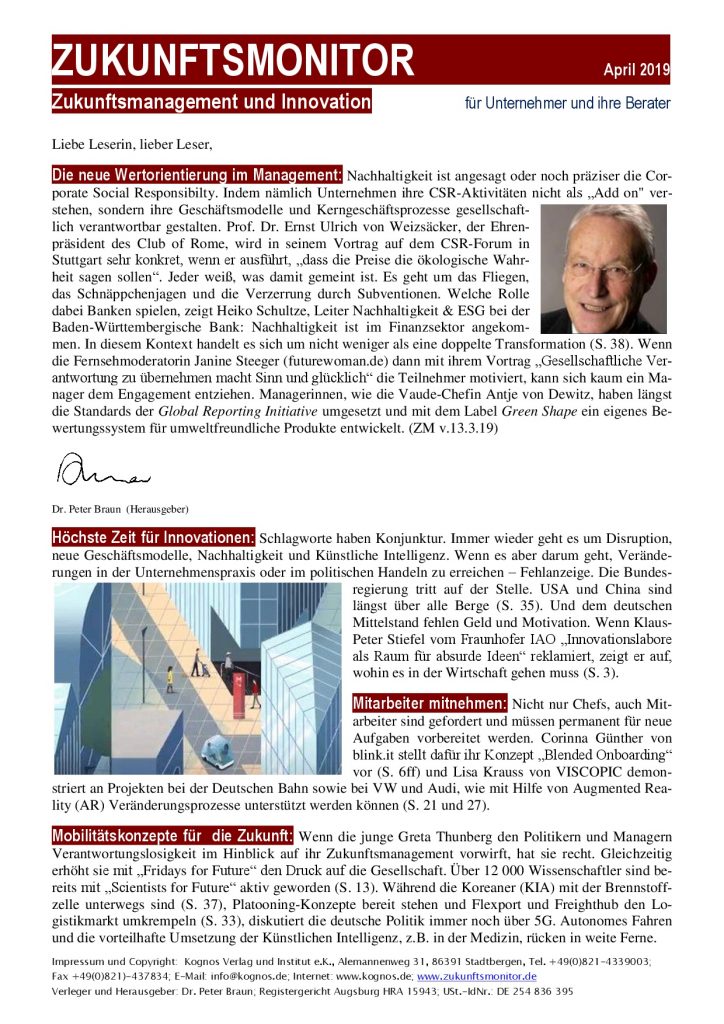
Zukunftsmonitor Januar/Februar 2019
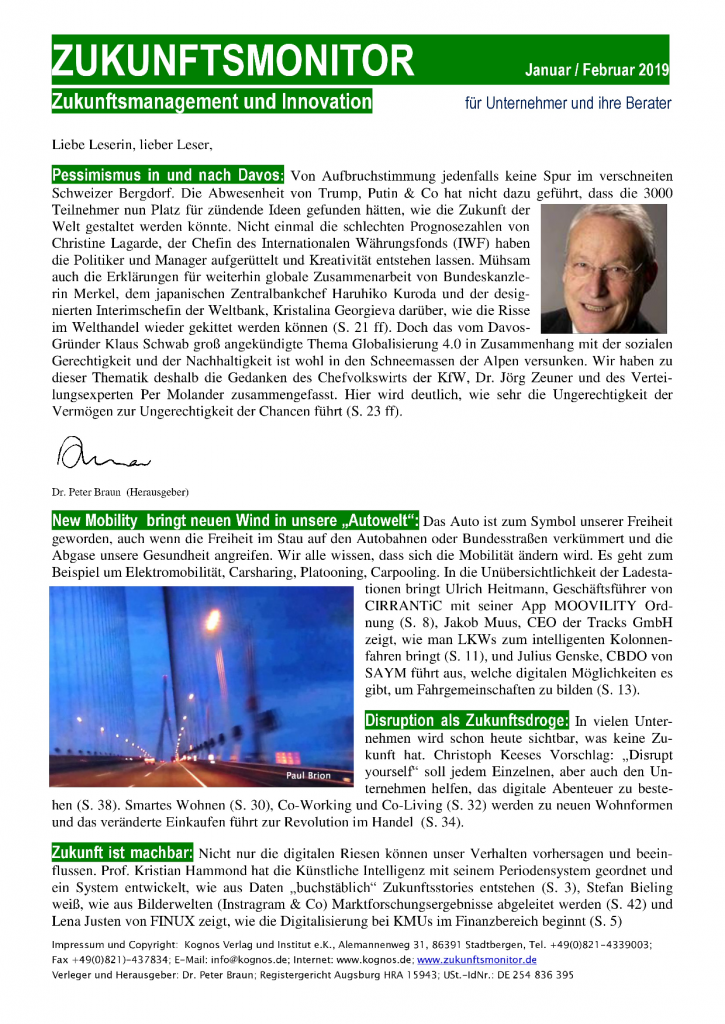
2018
Zukunftsmonitor Juli/August 2018
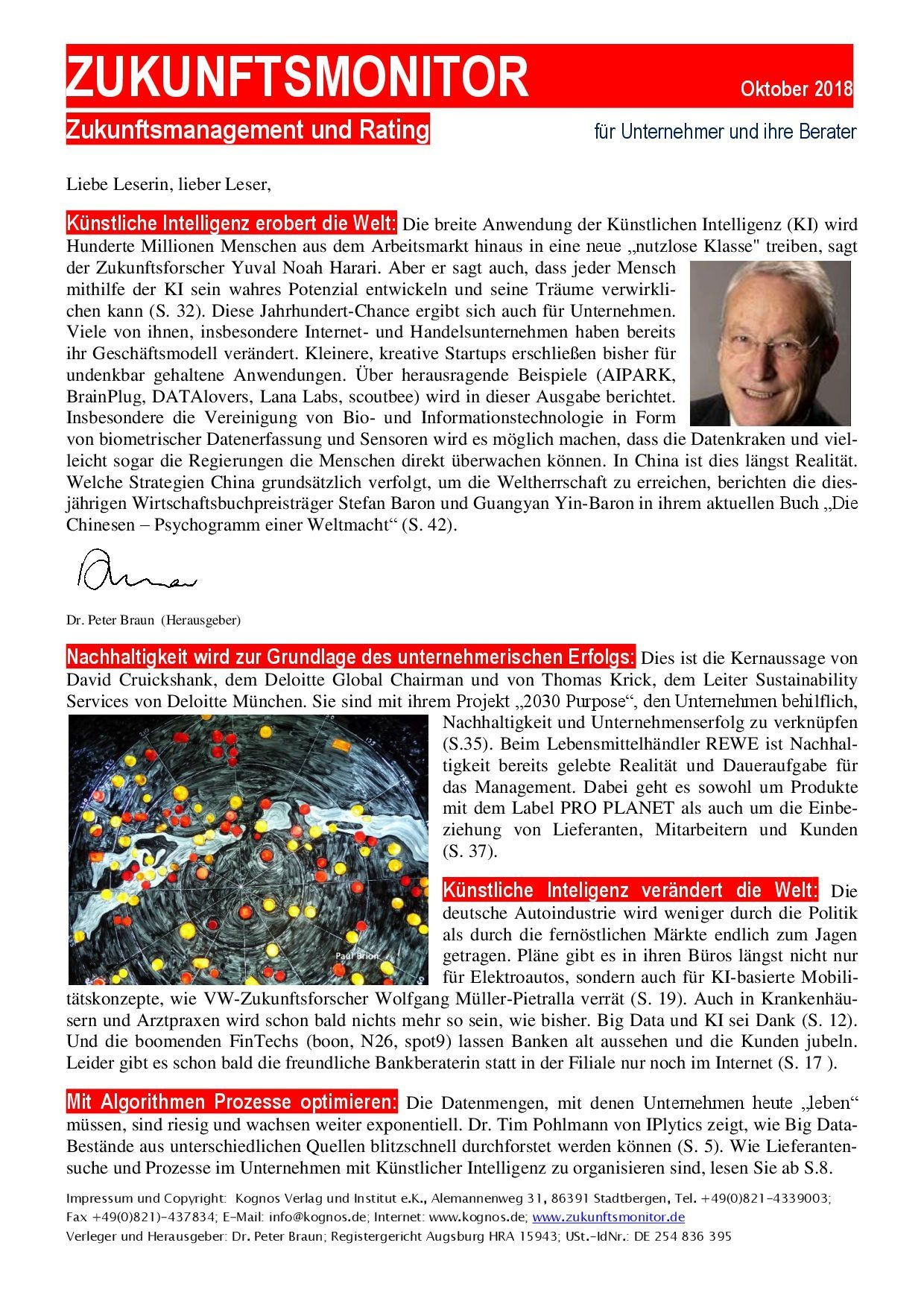
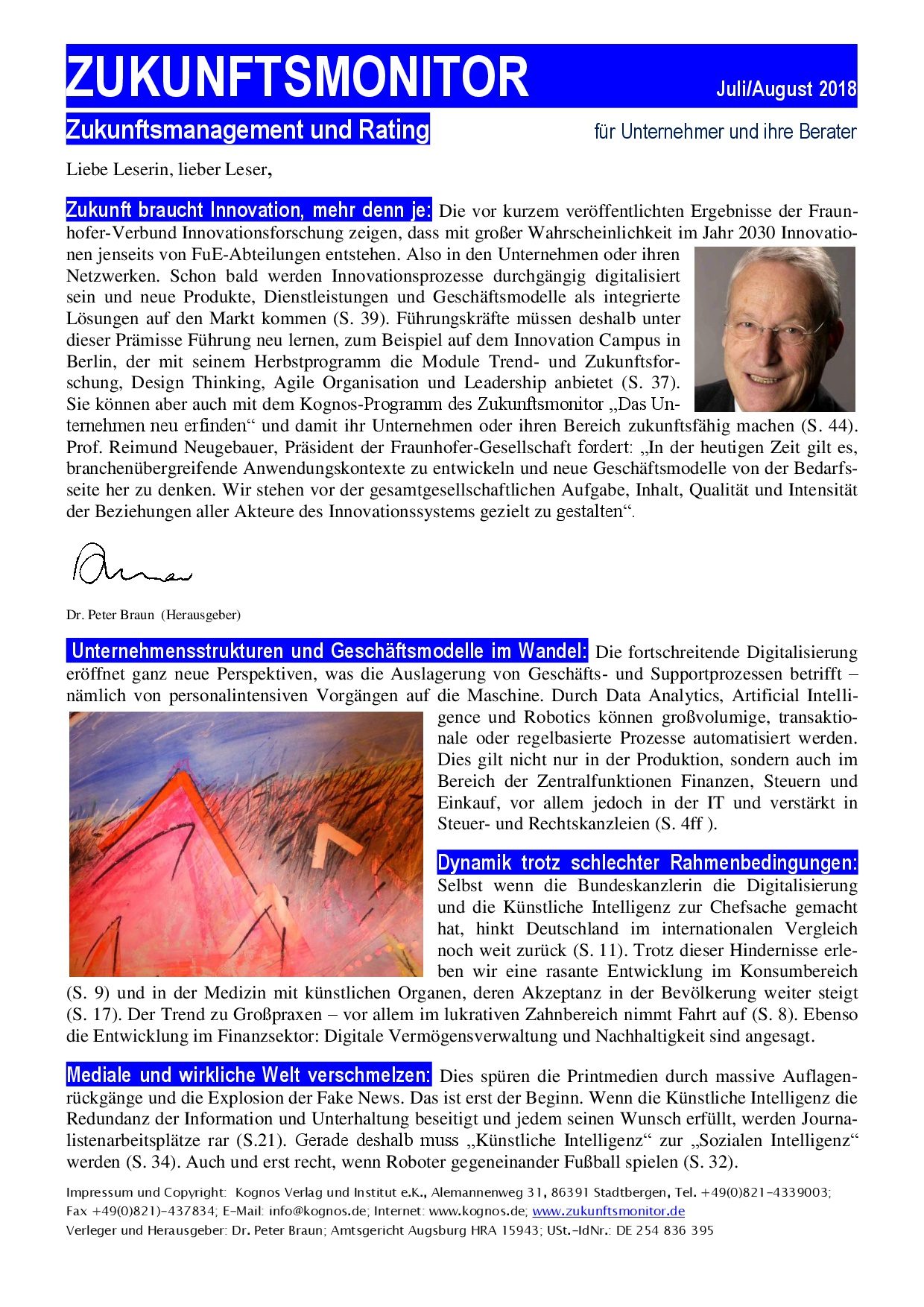
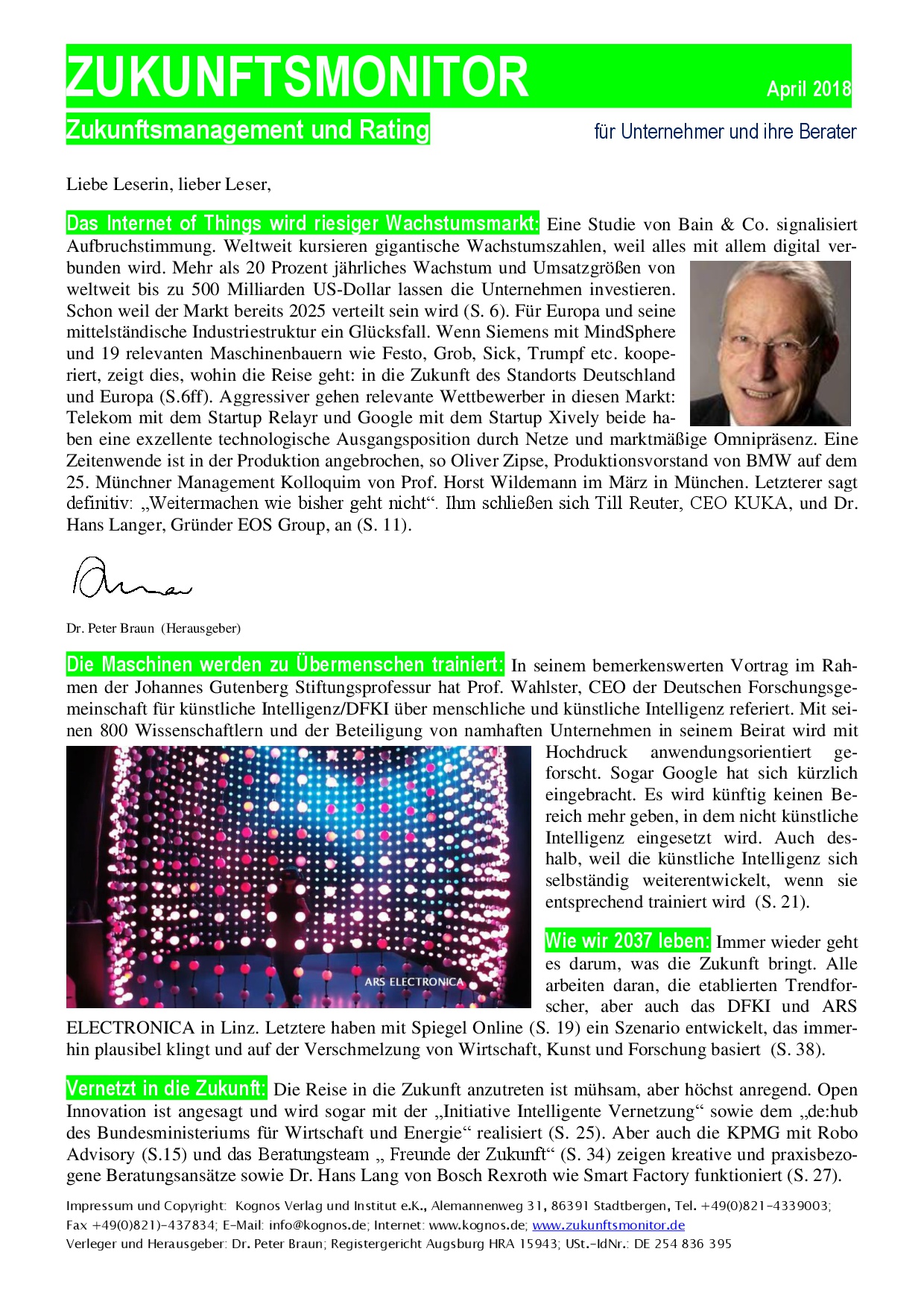
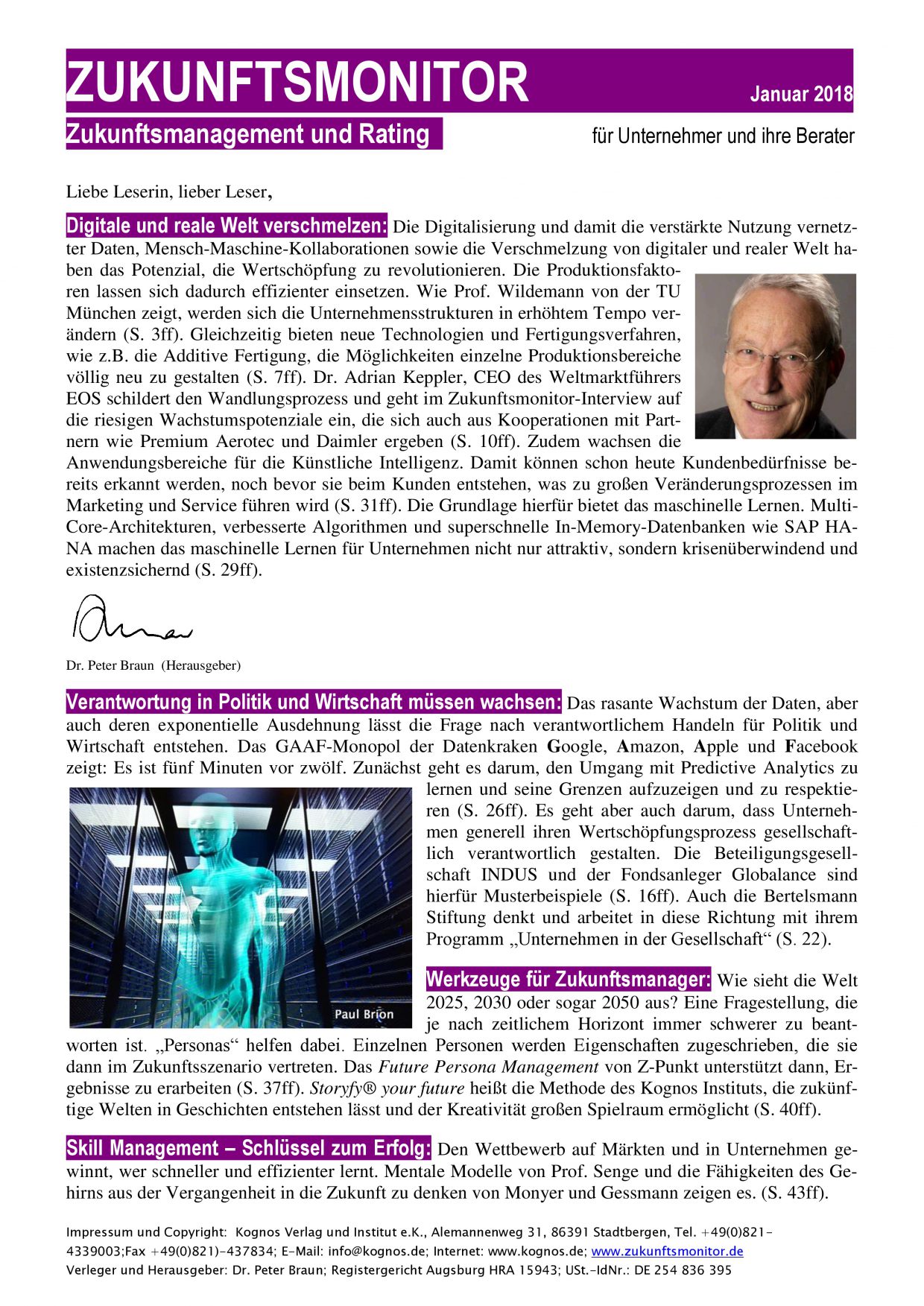
Zukunftsmonitor 3./4. Quartal 2021

Zukunftsmonitor 2. Quartal 2021
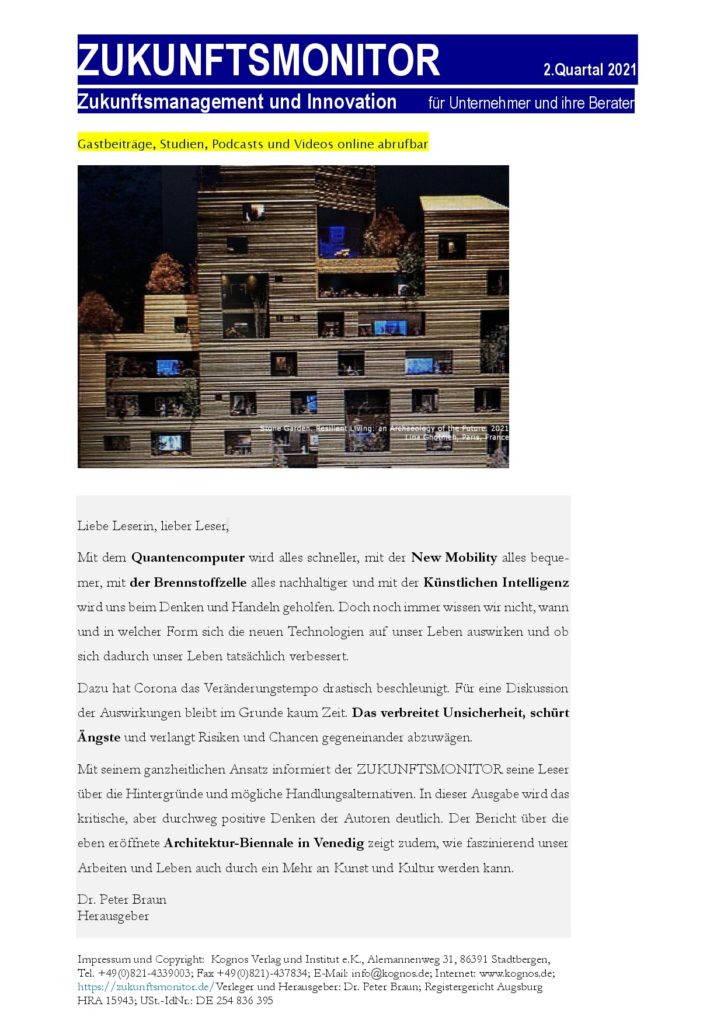
Zukunftsmonitor 1. Quartal 2021
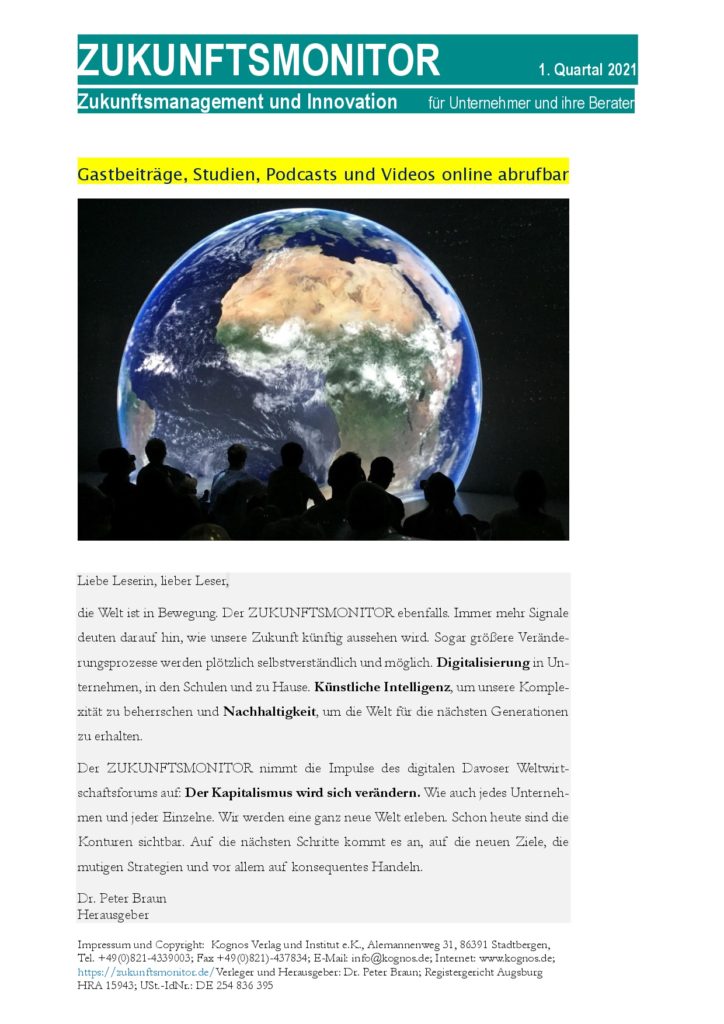
Zukunftsmonitor 4. Quartal 2020

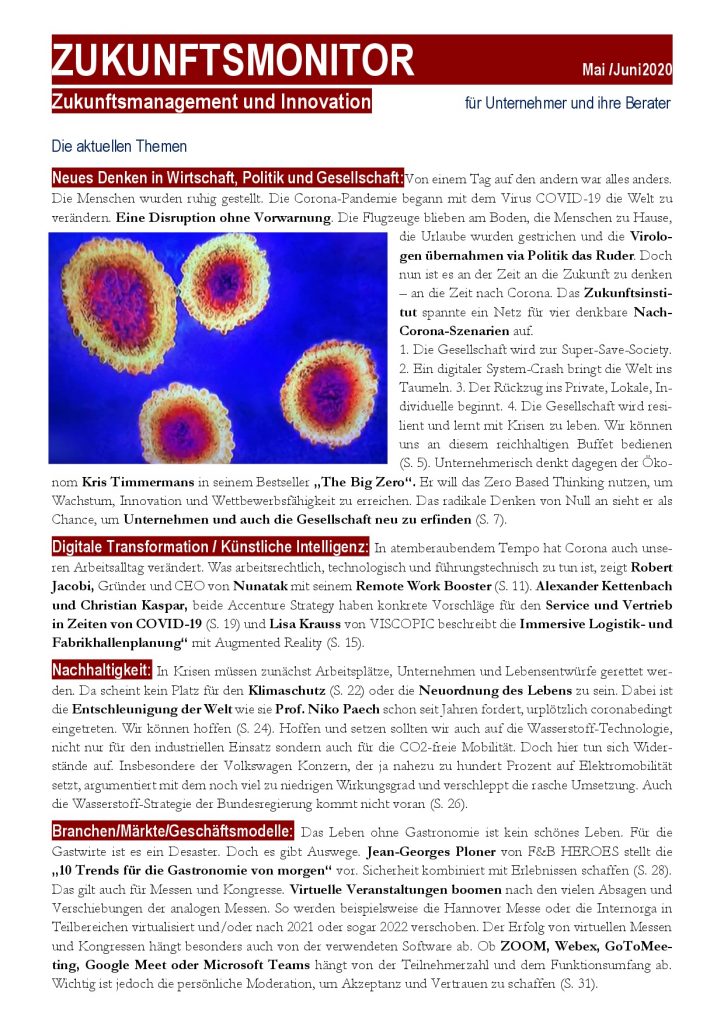
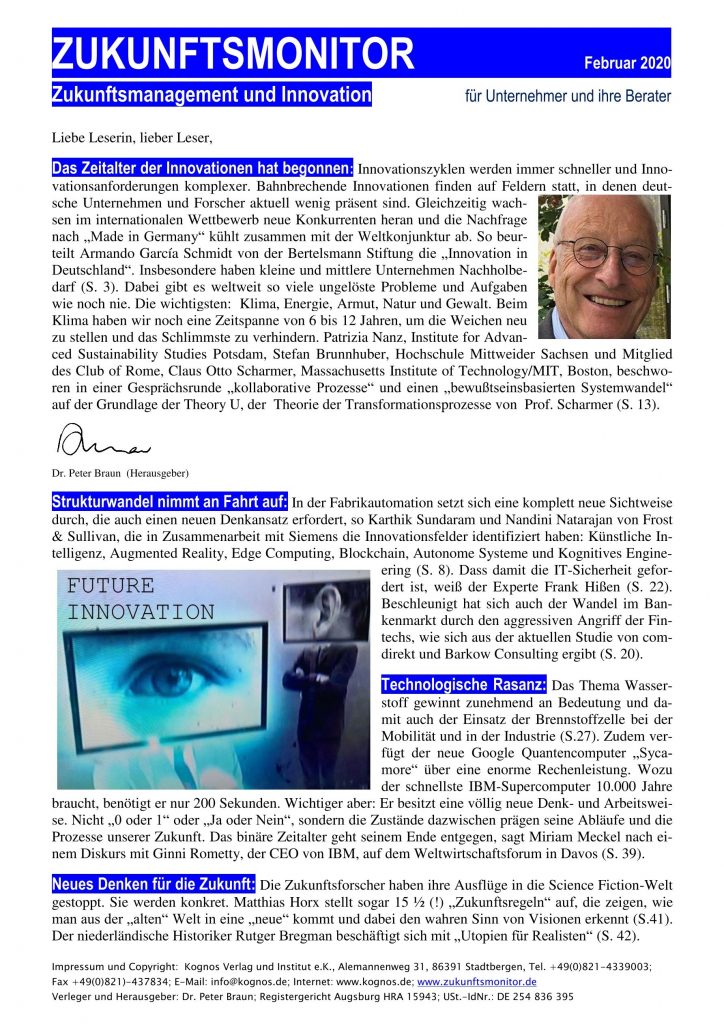
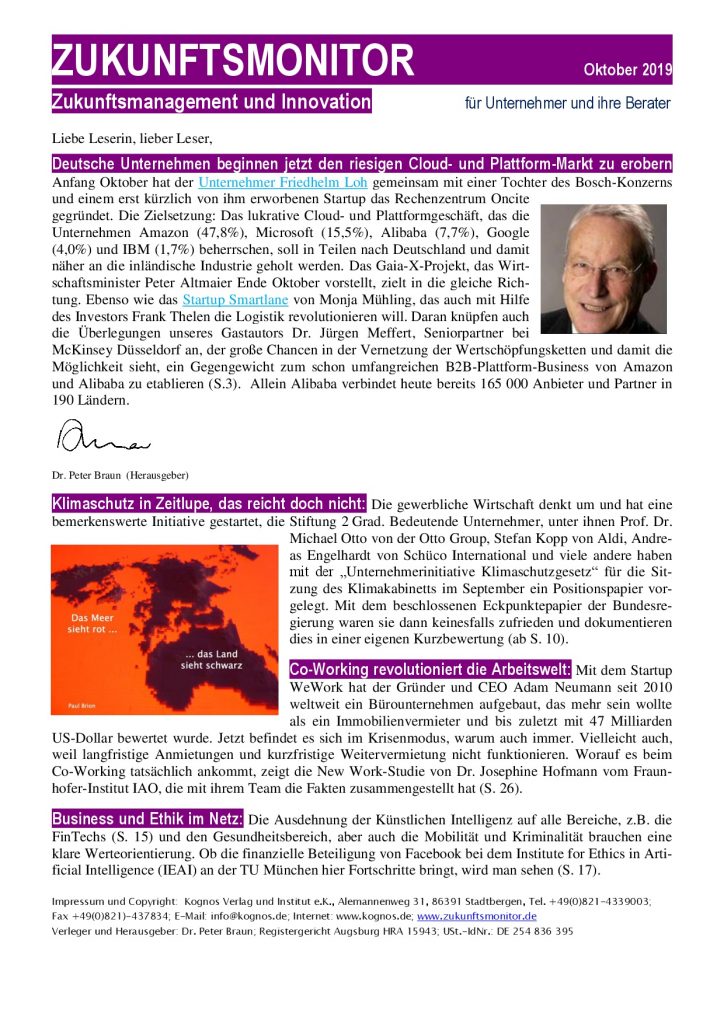
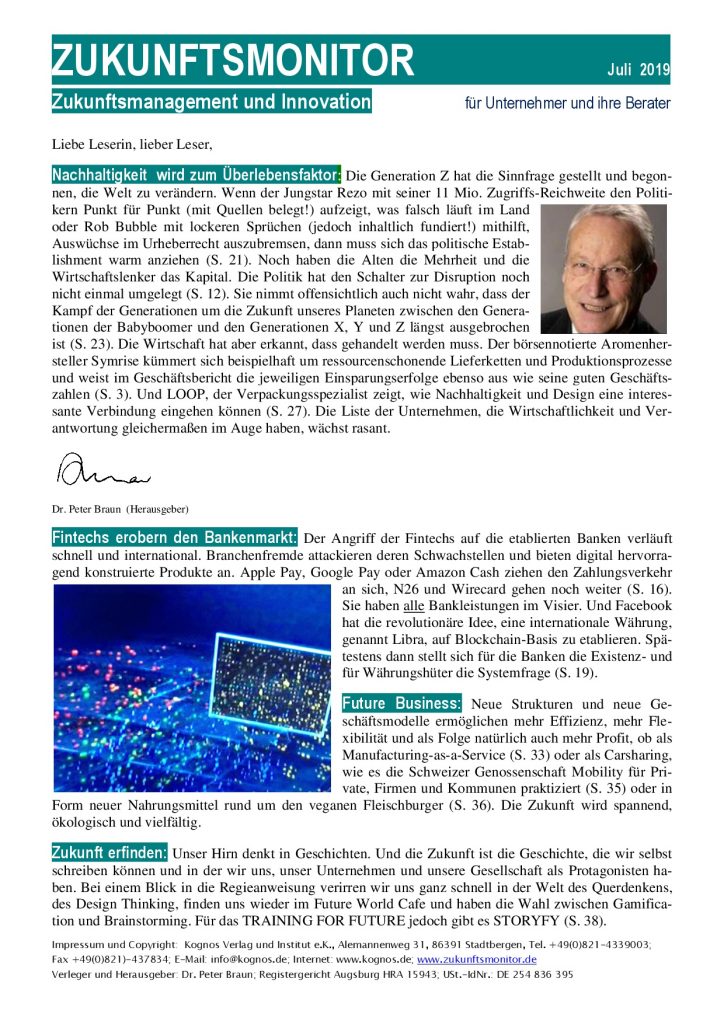
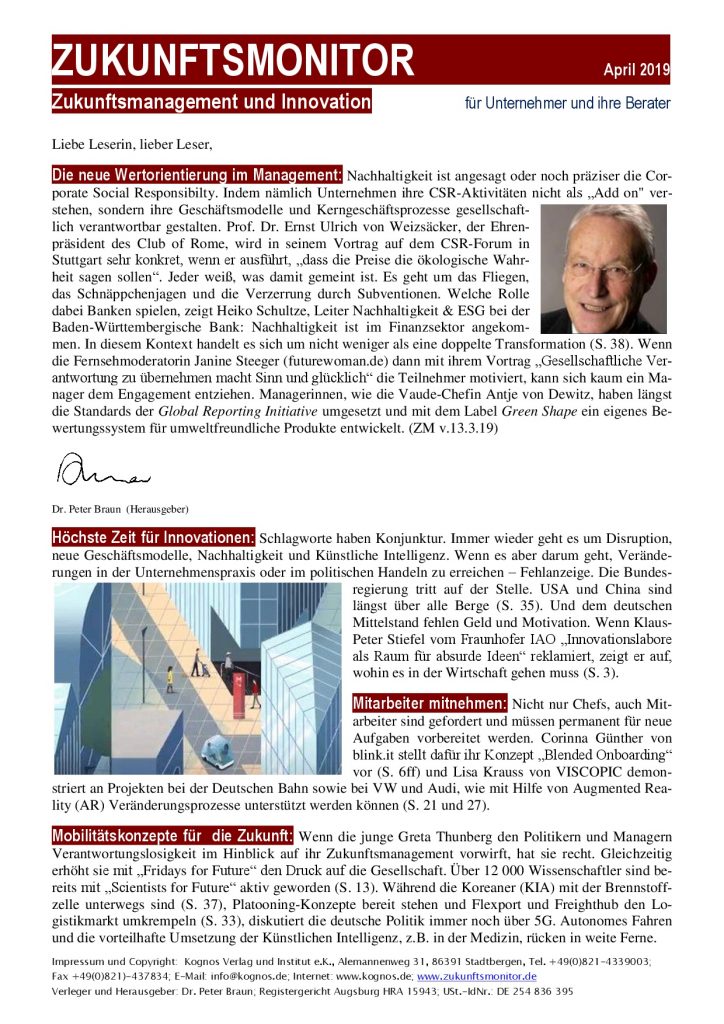
Zukunftsmonitor Januar/Februar 2019
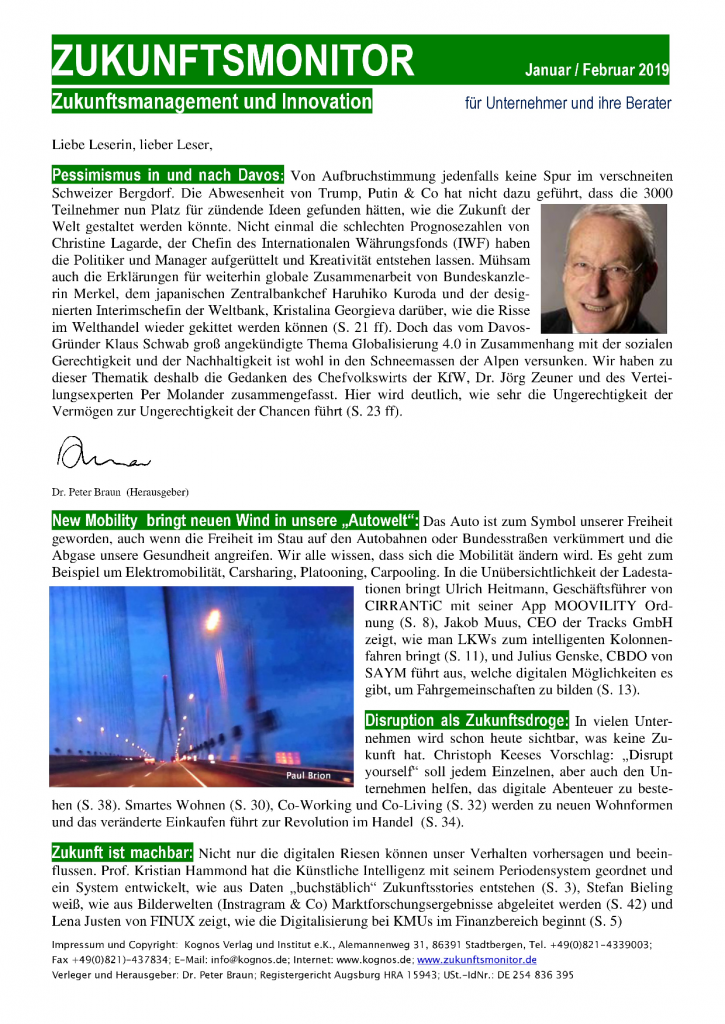
Zukunftsmonitor Juli/August 2018